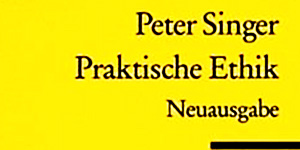Er ist der Spiritus Rector der Tierrechtsbewegung und ein rotes Tuch für BehindertenrechtlerInnen: Der australische Philosoph Peter Singer (64). Eine Ehrung der deutschen Giordano Bruno Stiftung sorgt nun für Kontroversen.
Im Jahre 1975 sorgte Singers Buch Animal Liberation für Aufsehen. Er fordert darin etwas für die damalige Zeit Revolutionäres: Rechte für Tiere. Der Mensch sei für das Tier ebenso verantwortlich wie für seine Mitmenschen. Tierversuche und Fleischkonsum sind deshalb Unrecht, das Töten von Tieren nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen moralisch vertretbar. Die Begründung: Tiere verfügen über Selbstbewusstsein (sind sich ihrer selbst bewusst), nehmen Schmerzen wahr, können Glück empfinden. Ein Wesen, auf das diese Eigenschaften zutreffe, habe ein Recht zu leben.
Selbstbewusstsein als Grundlage für Lebensrecht
Das heißt, dass die meisten Säugetiere und Vögel in dieser Hinsicht gleichberechtigt mit dem Menschen sein sollen. Wer sich seiner selbst bewusst ist und empfindet, hat ein Recht zu leben. So weit so gut, die Krux bei dieser Sache: Nicht alle Menschen sind voll bei Bewusstsein, nicht alle verfügen über ein Selbstbewusstsein und empfinden Schmerzen. Komapatienten etwa. Diese dürfe man nach Singers Theorie wohl töten. Und noch schlimmer: Säuglinge. Neugeborene sind sich ihrer selbst noch nicht bewusst. Der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan hat nämlich nachgewiesen, dass Kleinkinder erst im Alter von sechs bis 18 Monaten beginnen, sich selbst von der Umwelt unterscheiden können (hier wird dies „mirror stage“ genannt, da sich die Kinder im Spiegel selbst zu erkennen beginnen). Das heißt zwar nicht, dass man wahllos Babies töten dürfe. Bei behinderten Kindern sei dies jedoch in Erwägung zu ziehen. Die Begründung dafür liegt in der utilitaristischen Ethik Singers.
Morallehre genannt Utilitarismus
In dieser Morallehre gibt es kein Gut und Böse, sondern lediglich die Frage, ob eine Handlung nützlich ist. Nützlich ist, was Schmerz vermeidet und Glück schafft. Ein Reicher gibt hier einem Hungernden nicht etwa deshalb ein Stück Brot, um Gerechtigkeit zu schaffen, Nächstenliebe walten zu lassen oder einfach um Gutes zu tun, sondern er kalkuliert kühl durch: „Mich schmerzt der Aufwand für das Stück Brot weniger, als es dem Hungernden Glück bereitet. Die Handlung ist deshalb in Summe nützlich, also spende ich das Brot.“ Es handelt sich also um eine Interessenabwägung: Der Reiche hat zwar ein berechtigtes Interesse, sein Geld behalten zu dürfen, der Hungernde hat jedoch ein stärkeres Interesse zu überleben. Die Handlung ist nützlich und wird deshalb durchgeführt.
Interessenabwägung bei behinderten Neugeborenen
Bei behinderten Kindern kann dieser Interessenabgleich negativ ausfallen: Säuglinge mit schweren Behinderungen haben nach Singer in vielen Fällen keine Aussicht auf ein glückliches Leben. Insofern sie noch nicht über Selbstbewusstsein verfügen, können sie getötet werden, wenn dies den Interessen der Eltern entspricht. Singer fordert deshalb, dass gesetzliche Regelungen geschaffen werden sollen, die es Eltern ermöglicht, im Falle eines behinderten Neugeborenen mit den Ärzten gemeinsam zu entscheiden, ob das Kind leben soll, oder getötet wird.
Am 3. Juni wird Singer nun der Ethik-Preis der Giordano Bruno Stiftung überreicht. Die Verantwortlichen verteidigen ihre Entscheidung und sprechen von „manipulativem Journalismus“. Für weitere Debatten ist gesorgt.
Aktion „Grüße von Ungewollten“:
Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland schickt „Grüße von Ungewollten“ an die Giordano Bruno Stiftung um auf die Empörung von Behinderten aufmerksam zu machen.
Link
[kobinet-nachrichten: „Oliver Tolmein kommentiert Preisverleihung an Peter Singer“]
AutorIn: Redaktion
Zuletzt aktualisiert am: 16.06.2017
Artikel-Kategorie(n): Eugenik und Menschenwürde, News
Permalink: [Kurzlink]